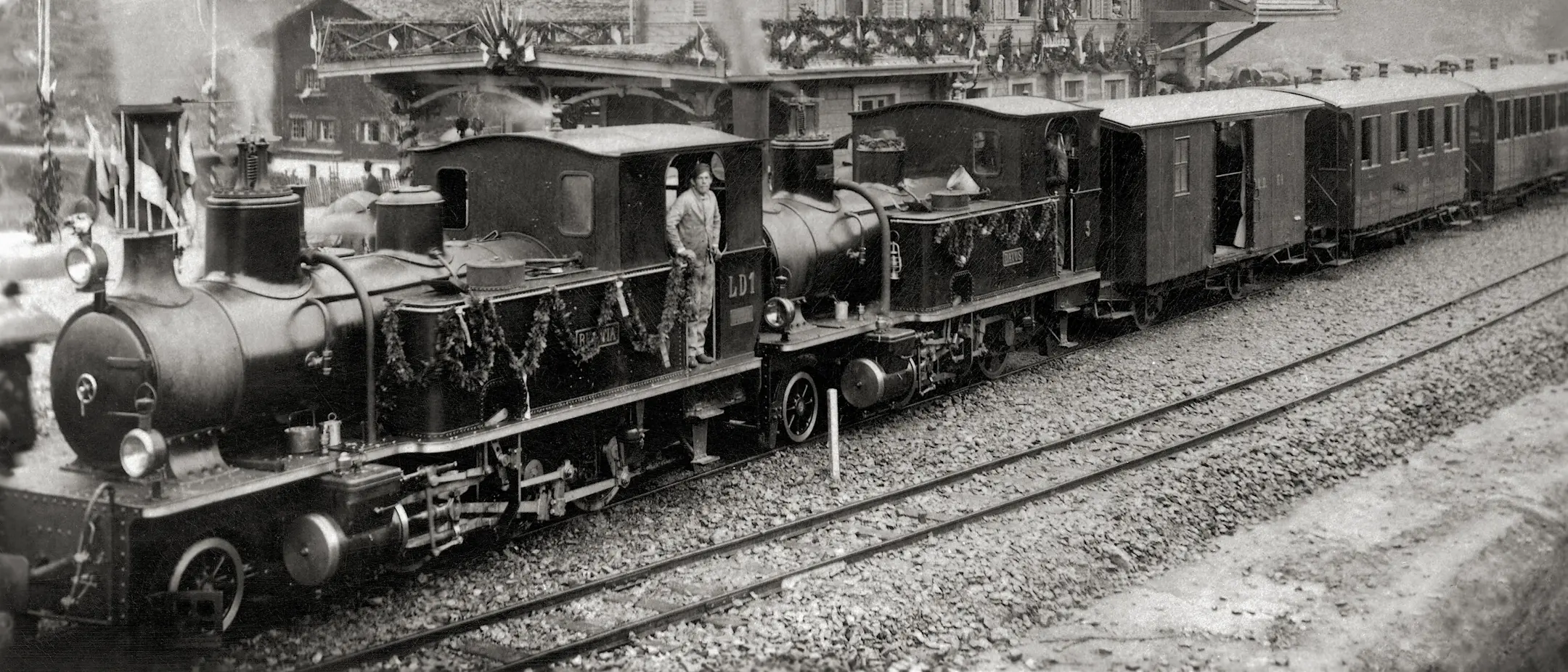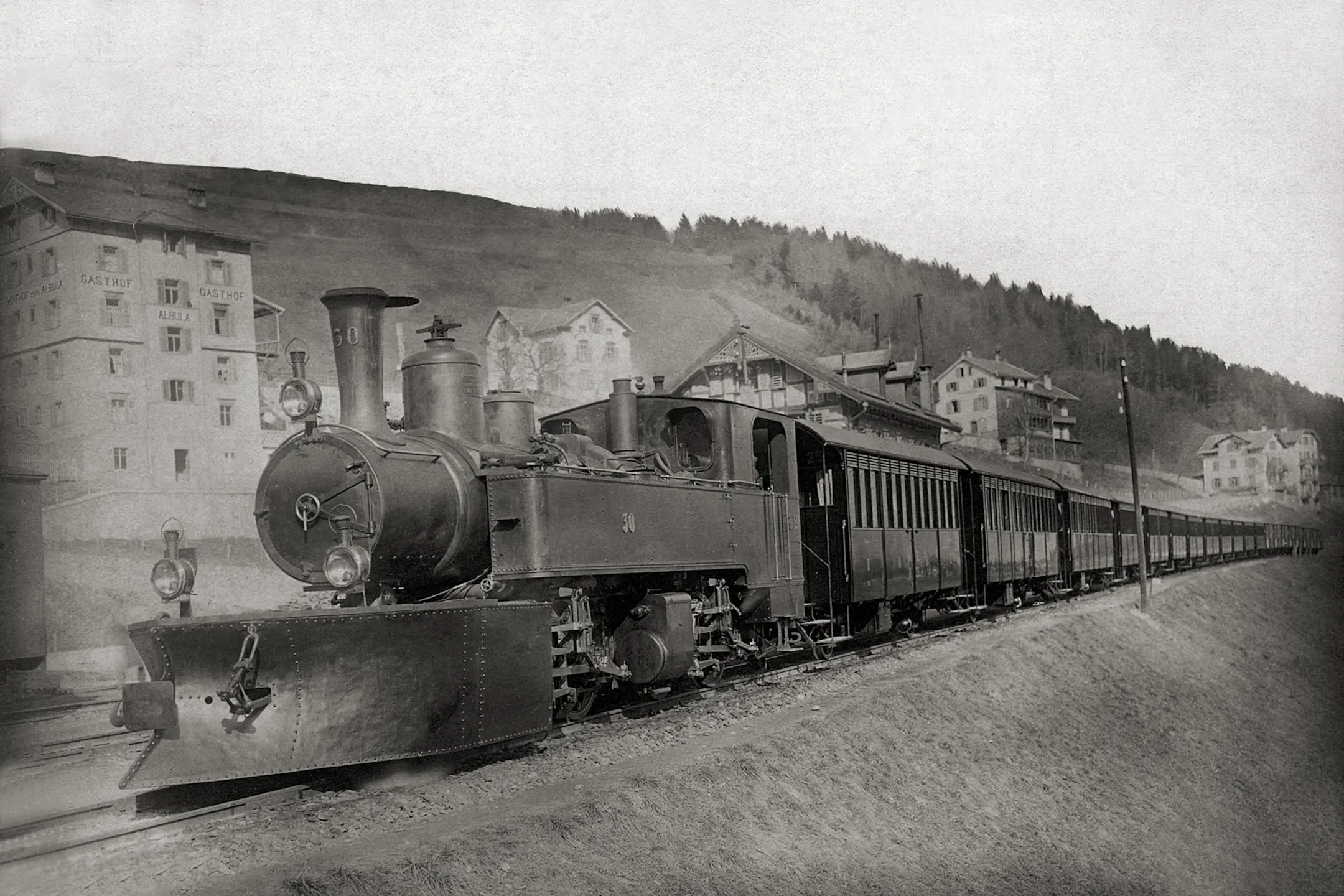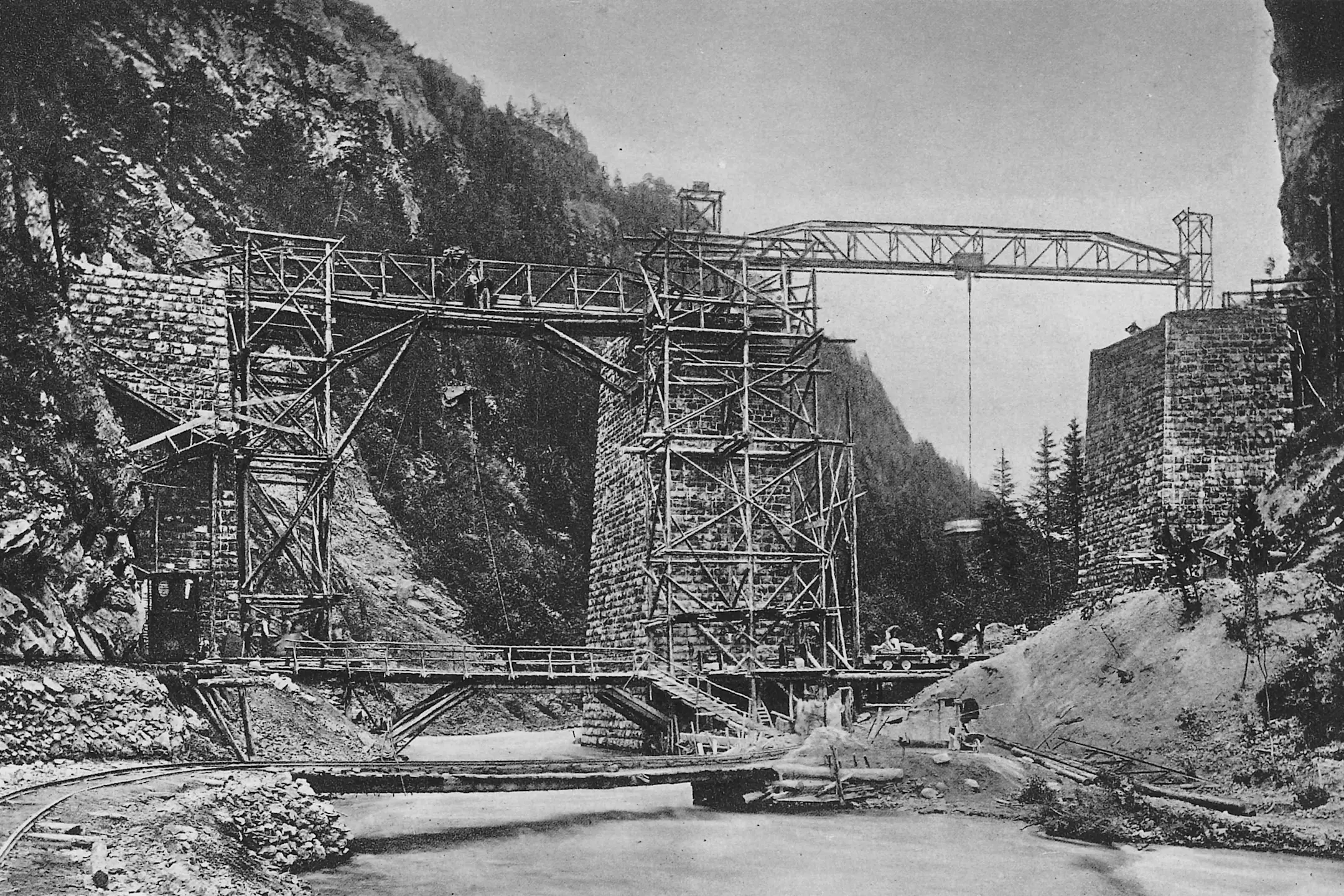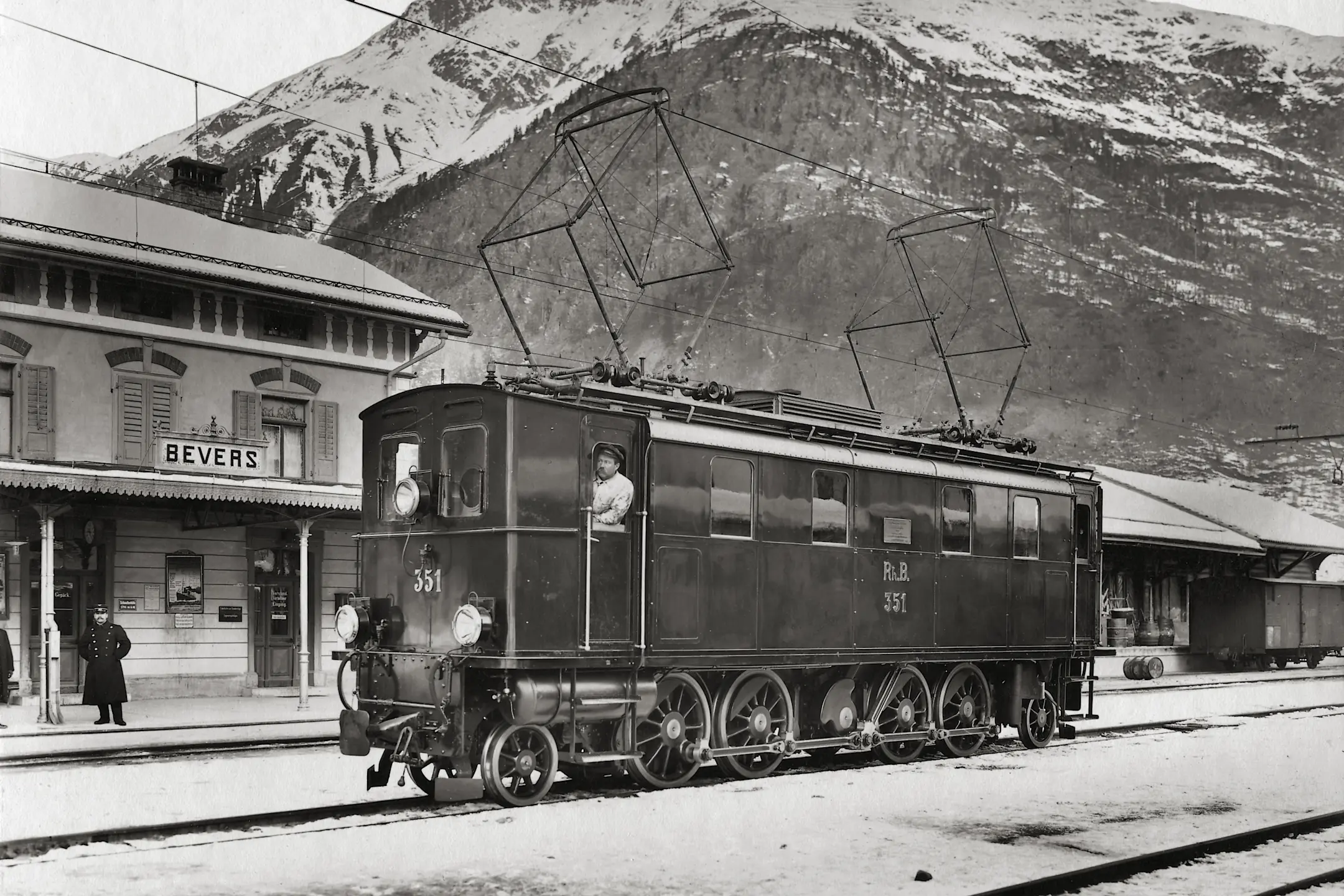Was mit einer mutigen Vision begann, wurde zu einer Lebensader Graubündens: Seit 1889 bringt die Rhätische Bahn Menschen und Güter durch eine der eindrucksvollsten Landschaften Europas. Die RhB-Geschichte ist ein Zeugnis von Pioniergeist, technischer Innovation und Verbundenheit zur Natur.
Damals, 1888, träumte der Niederländer Willem-Jan Holsboer von einer Bahnlinie, die den Kurort Davos mit dem Tal verbindet. Der Traum nahm schnell Fahrt auf: Die Schmalspurbahn Landquart-Davos AG wurde gegründet. Bereits ein Jahr später fuhr der erste Dampfzug von Landquart nach Klosters, wenig später bis nach Davos.
Mit jedem neuen Tunnel, jeder Brücke und jeder Kurve wuchs das Netz: Es entstanden Strecken nach St. Moritz, Disentis und Scuol-Tarasp. Parallel dazu wurden andere Bahnprojekte in Angriff genommen: Die Arosabahn baute die Strecke von Chur nach Arosa, die Berninabahn die spektakuläre Linie über den Berninapass. Beide Bahnen wurden später durch Fusionen in die RhB integriert.
Nur 25 Jahre nach dem ersten Spatenstich war fast das gesamte heutige Streckennetz in den Bündner Alpen erstellt. Der Vereinatunnel, 1999 eröffnet, markierte den jüngsten Meilenstein der RhB-Geschichte auf dem Weg zum 385 Kilometer langen Streckennetz.
Bis heute fährt die RhB auf schmaler Spur und doch mit weitem Blick. Mit dem UNESCO Welterbe RhB, dem Bernina Express, dem Glacier Express und vielen weiteren Angeboten schreiben wir unsere Geschichte fort: als Teil der Region, als Brücke zwischen Kulturen und als Einladung, Graubünden auf faszinierend andere Weise zu entdecken.
Wie die Reise begann
Die Anfänge der RhB
Bereits die Römer nutzten die Bündner Pässe als Militärstrassen und Handelswege. Die Alpenpässe dienten als wichtige Säumerrouten. Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte deren Ausbau. Unter der Regie von Ingenieur Richard La Nicca entstanden die wichtigsten Achsen des bündnerischen Strassennetzes. La Niccas Leidenschaft galt jedoch der aufkommenden Eisenbahntechnik. Zusammen mit Tiefbauingenieur Simeon Bavier regte er die Erstellung einer Ostalpenbahn an. Diese sollte den Norden mit dem Süden verbinden und über den Lukmanier-, den Greina- oder den Splügenpass führen. Die vorgeschlagene Transitverbindung war jedoch nur eine unter vielen und wurde nie gebaut. Es war Simeon Bavier selbst, der für das Ende der Bündner Alpenbahnprojekte sorgte. Als Bundespräsident der Schweiz eröffnete er 1882 die Gotthardlinie. Eine Transitverbindung durch Graubünden war damit vom Tisch. Man konzentrierte sich fortan auf Bahnprojekte innerhalb des Kantons, die aber alle an politischen Auseinandersetzungen oder finanziellen Engpässen scheiterten. Erst mit dem Holländer Willem Jan Holsboer wendete sich das Blatt.
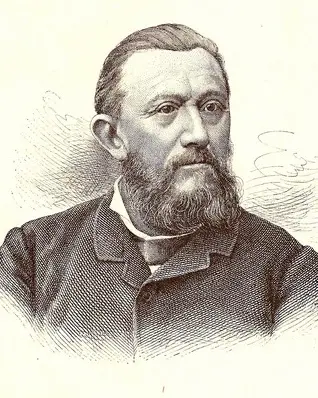
Schmalspurbahn Landquart–Davos
Holsboer zog wegen seiner kranken Frau in den Kurort Davos, wo er auch nach ihrem Tod blieb. Für ihn war früh klar, dass nur die Eisenbahn dem Kurort zum Durchbruch verhelfen konnte. Nachdem das Projekt einer Normalspurbahn von Landquart nach Davos aufgrund zu hoher Kosten nicht umgesetzt wurde, trat er mit einem neuen Projekt an die Öffentlichkeit: Eine Schmalspurbahn mit Baukosten von rund fünf Millionen Schweizer Franken sollte Davos erschliessen. Drei Basler Finanzleute waren bereit, die Bahn zu finanzieren, falls die Gemeinden des Prättigaus und Davos die von ihnen geforderten Leistungen erbrachten. Diese umfassten unter anderem die Bereitstellung von Sand, Kies, Steinen und Holz für den Bahnbau sowie Subventionen der Gemeinden Klosters und Davos.
Sämtliche Gemeinden stimmten im September 1886 deutlich zu, den Forderungen zu entsprechen. Der Weg für die Eisenbahn war frei. Im Februar 1888 wurde die Schmalspurbahn Landquart–Davos AG gegründet. Noch im selben Jahr begann der Bau der Strecke Landquart–Davos. Erstellt wurde eine reine Adhäsionsstrecke (d. h. ohne Zahnrad) mit einer Steigung von 45 Promille. Zeitweise standen rund 3'300 Arbeiter im Einsatz, darunter viele Italiener, aber auch Einheimische aus den Talgemeinden. Im September 1889 konnte das erste Teilstück von Landquart nach Klosters und ein Jahr später die gesamte Strecke bis Davos eröffnet werden.

Albula statt Scaletta
Holsboer plante noch während des Baus der ersten Strecke eine Weiterführung von Davos via Scaletta ins Engadin. Eine Konzession für den Bau der Scalettabahn erhielt er bereits 1889. Die Reaktion aus Chur folgte sofort. Weder der Kanton noch die Stadt Chur wollten, dass die Nord-Süd-Verbindung am Hauptort und der bevölkerungsreichsten Region des Kantons vorbeiführte. Auch die verschiedenen Komitees, die seit Längerem eine Eisenbahnverbindung von Chur nach Thusis planten, vereinten sich. Ein hitziger Abstimmungskampf zwischen Zentrum und Peripherie entbrannte. Im November 1889 fand der Kampf sein Ende. Das Bündner Stimmvolk entschied sich mit rund 70 Prozent für eine Erschliessung des Engadins via Albula und damit gegen die Scalettabahn.
Kanton übernimmt die Federführung
Holsboer respektierte den Entscheid und trieb die Erstellung eines einheitlichen Bündner Schmalspurnetzes voran. Die Umbenennung der Schmalspurbahn Landquart–Davos in Rhätische Bahn am 12. Februar 1895 war die logische Folge des Streckenausbaus. Im Jahr 1897 definierte der Kanton in einem neuen Eisenbahngesetz zwei Prioritätslinien, an deren Bau er sich finanziell beteiligte (Thusis–Samedan, Reichenau–Ilanz) und zwei Komplementärlinien, die das Streckennetz zu einem späteren Zeitpunkt vollenden sollten (Ilanz–Disentis, Samedan–Scuol). Gleichzeitig übernahm er alle RhB-Aktien. Die Bahn gehörte von nun an dem Kanton Graubünden.
Vollständige Chronik
Jahr
Ereignis
1889
Eröffnung der Strecke Landquart – Klosters durch die Schmalspurbahn Landquart-Davos (LD)
1890
Eröffnung der Strecke Klosters – Davos
1895
Die LD nennt sich von nun an «Rhätische Bahn»
1896
Eröffnung der Strecke Landquart – Thusis
1903
Eröffnung der Strecke Reichenau – Ilanz
1904
Eröffnung der Strecke Thusis – St. Moritz
1907
Eröffnung der Strecke Bellinzona – Mesocco
1908
Eröffnung der Strecke Samedan – Pontresina
1909
Eröffnung der Strecke Davos – Filisur
1910
Eröffnung der Strecke St. Moritz – Tirano (Berninabahn)
1912
Beschaffung der ersten elektrischen Lokomotive; Eröffnung der Strecke Ilanz – Disentis/Mustér
1913
Eröffnung der Strecke Bever – Scuol-Tarasp
1914
Eröffnung der Strecke Chur – Arosa (Chur-Arosa Bahn)
1922
Abschluss der Elektrifizierung der Rhätischen Bahn
1930
Erste Fahrt des Glacier Express auf der Strecke St. Moritz – Zermatt
1942
Fusion der RhB mit der Chur-Arosa Bahn; Fusion der RhB mit der Bellinzona-Mesocco Bahn
1943
Fusion der RhB mit der Berninabahn
1973
Einführung des Bernina Express
1979
Schwesterbeziehung mit Hakone-Tozan-Railway (Japan)
1982
Eröffnung des Furka-Basistunnels (Ganzjahresverbindung für den Glacier Express)
1989
100-jähriges Jubiläum - Die RhB erhält ein neues Erscheinungsbild und die Züge werden neu rot gestrichen
1997
Umelektrifizierung der Strecke Chur – Arosa von 2 400 V Gleichstrom auf 11 000 V Wechselstrom
1999
Eröffnung der Strecke Klosters – Lavin/Susch (Vereinatunnel mit Autoverlad) - erste Streckenverlängerung seit 1914
2003
Stilllegung der Strecke Bellinzona – Mesocco
2008
Die Albula- und Berninalinie werden in die UNESCO Welterbeliste aufgenommen